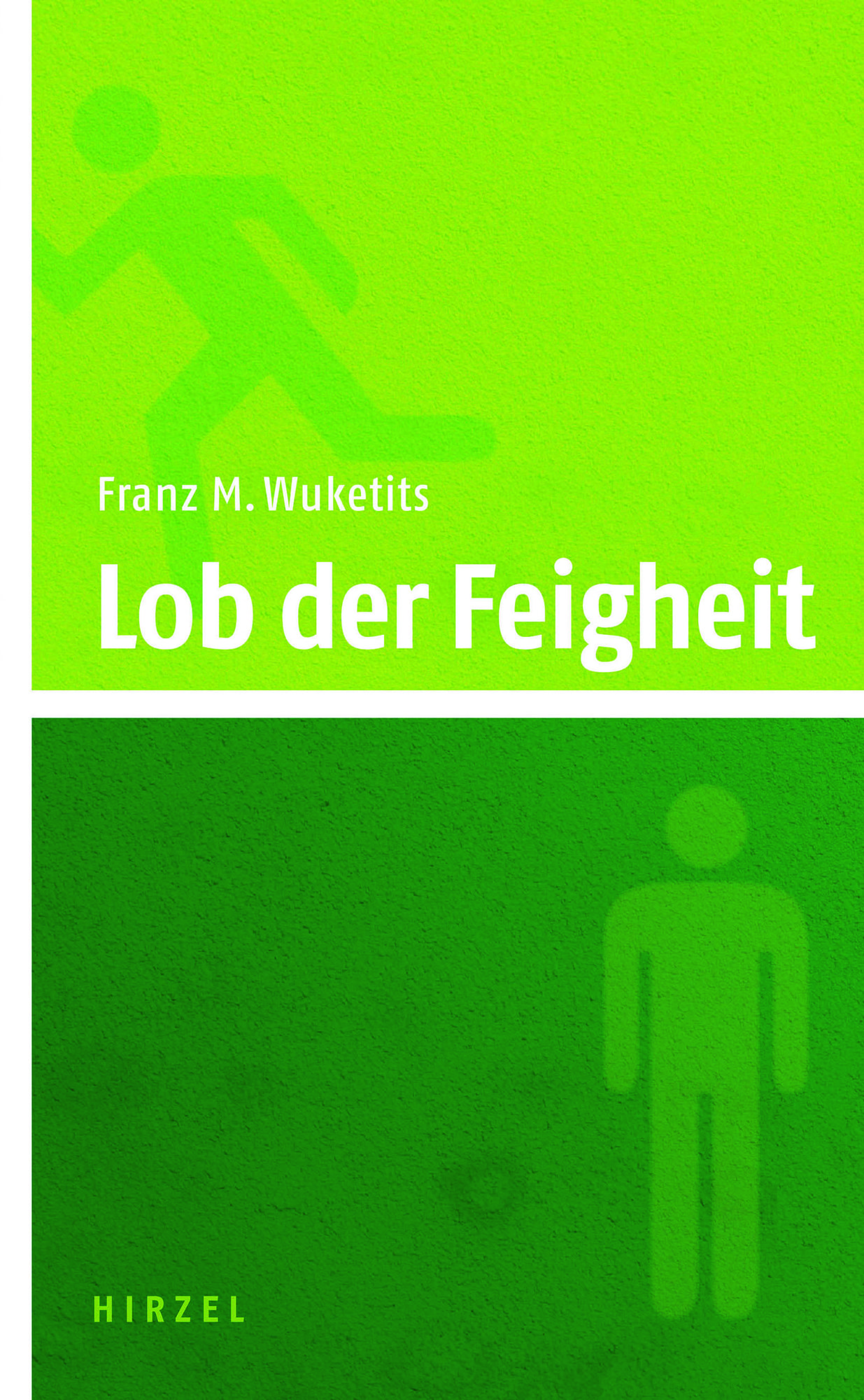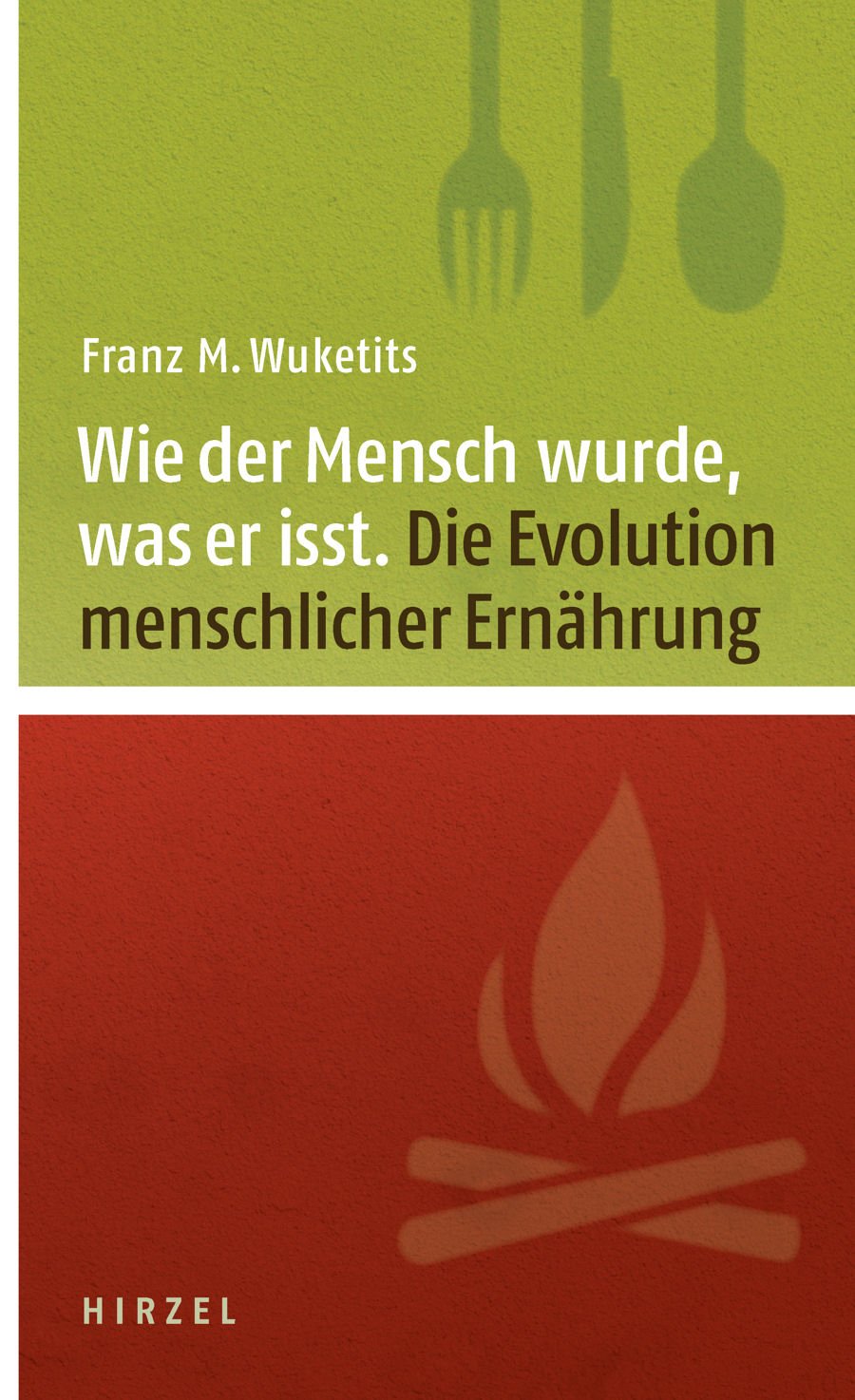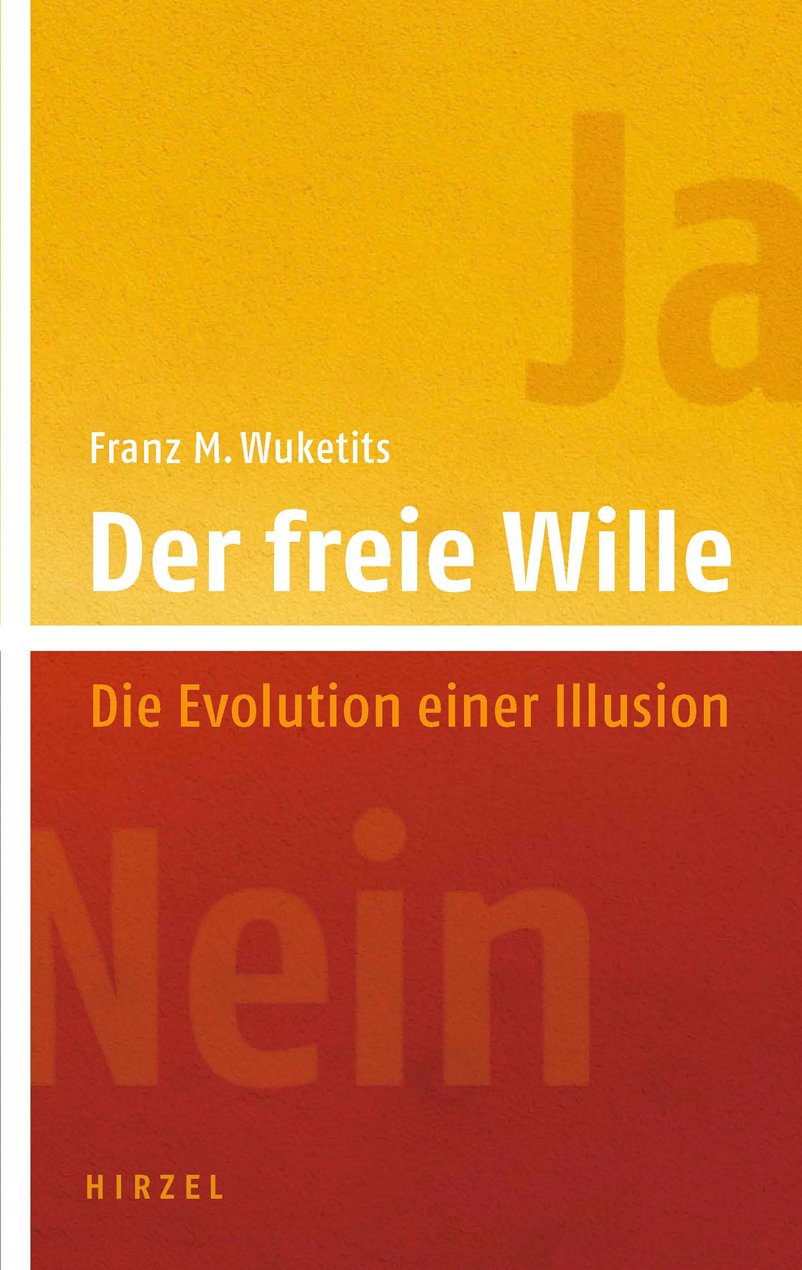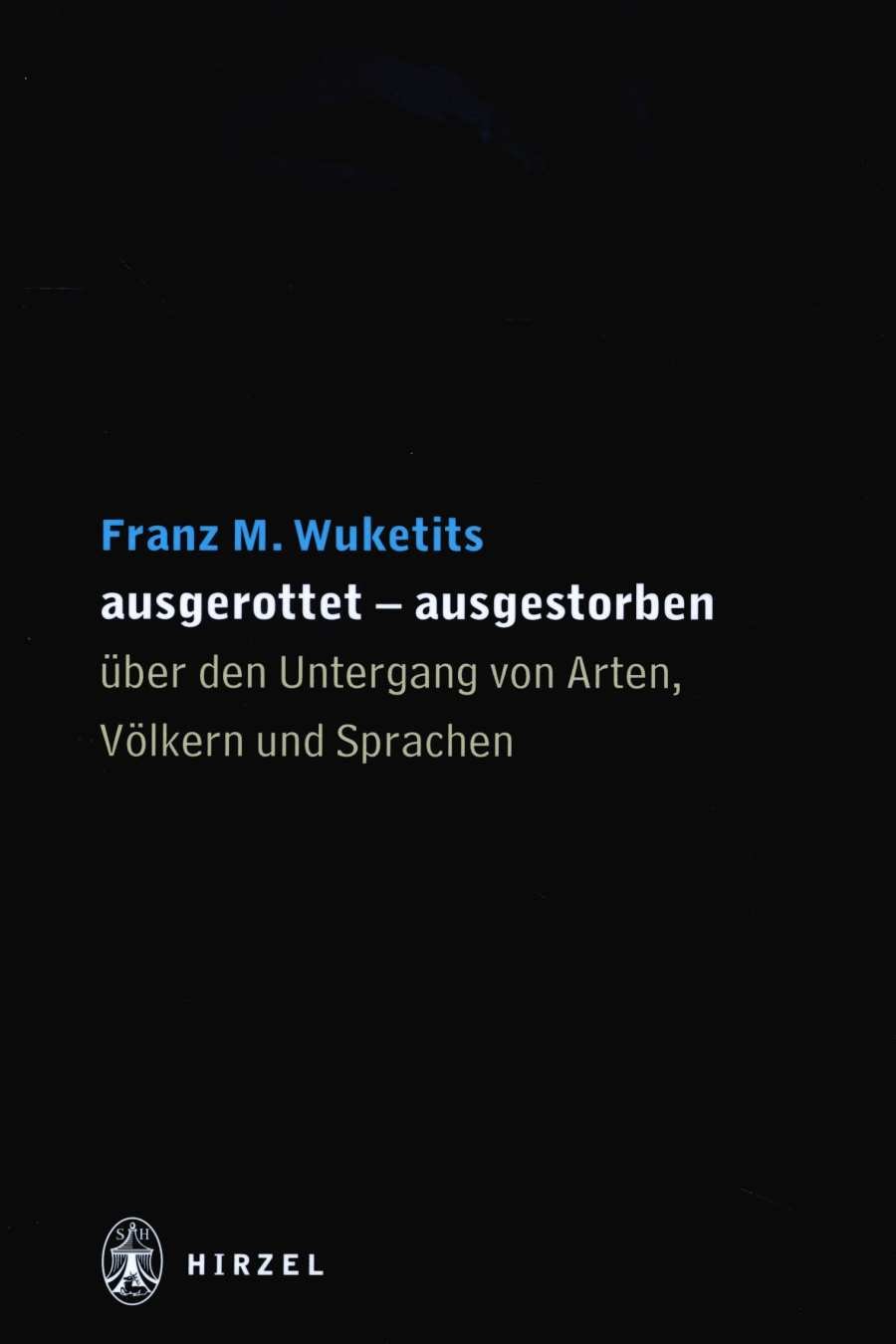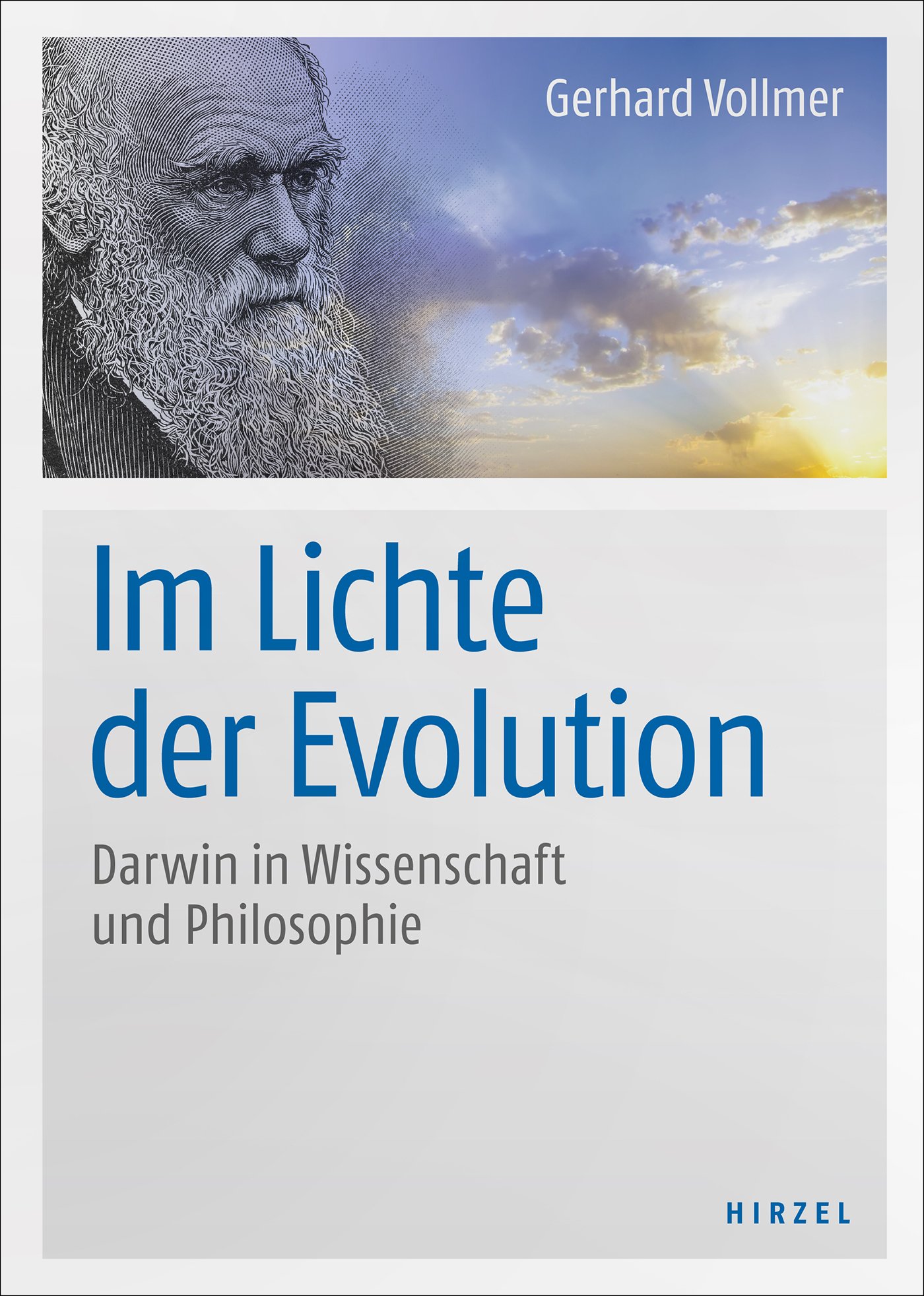Lob der Feigheit
Wir haben zu viele tote Helden, aber zu wenige lebende Feiglinge!
Es lebe der Hasenfuß!Mut wird stets gefordert. Dabei tut uns Menschen auch eine gewisse Portion Feigheit ganz gut, schreibt der Evolutionstheoretiker Franz M. Wuketits.“Sei tapfer!“ „Trau dich doch!“ – kaum jemand bleibt von solchen Aufforderungen verschont. Mancher muss sich zugleich als Feigling beschimpfen lassen. Risikobereitschaft ist gefragt, vor allem in der Wirtschaft. Dem Duckmäuser wird kein Erfolg versprochen. Wer nicht wagt, gewinnt nicht, sagt der Volksmund, dem Mutigen gehört die Welt.Schließlich zählt Mut oder Tapferkeit (neben Klugheit, Besonnenheit und Gerechtigkeit) seit der Antike zu den vier Kardinaltugenden. Feigheit hingegen gilt als Untugend. Verehrt werden Helden, nicht Feiglinge.Aber es ist höchste Zeit, die schiefe Optik, in der uns Feigheit erscheint, geradezurücken. Wir haben nämlich zu viele tote Helden und zu wenig lebende Feiglinge!Zwar hat uns die Evolution mit einer gewissen Neigung zum Risiko ausgestattet, und wer nicht ab und an etwas wagt, führt ein ärmliches Leben. Allerdings gehört eine Neigung zur Vorsicht ebenfalls zu unserer evolutionären Grundausstattung. Mag sein, dass ausgesprochene Angsthasen manche Chance verpassen, aber Menschen, denen Angst grundsätzlich fremd ist, haben keine hohe Lebenserwartung. Wie oft, ist auch in diesem Fall die Natur klüger als menschliche Wunschvorstellung.Wir bewundern viele Tiere, die sich scheinbar unerschrocken jeder Gefahr stellen. Zugleich empfinden wir Angst vor jenen angriffslustigen Bestien, die alles vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt. Dabei brauchen wir nicht an Fabeltiere wie Seeschlangen und andere Ungeheuer zu denken, weil verschiedene Geschöpfe der realen Natur in unserem Bewusstsein ohnehin die Rolle von Monstern einnehmen. Besonders Haie gelten als äußerst gefährliche Kreaturen, wozu nicht zuletzt Steven Spielbergs immer wieder im Fernsehen ausgestrahlter Film „Der weiße Hai“ beiträgt.Nun stimmt es zwar, dass Haie gelegentlich Menschen angreifen und töten, aber das kolportierte Bild eines Meeresungetüms ist eine ziemliche Übertreibung. Haie sind keineswegs besonders mutige Angreifer. Bereits vor über dreißig Jahren schrieb dazu der Meeresbiologe Hans Hass und der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt: „Sogar dem toten Menschen nähert sich der Hai – wie aus Berichten der Schiffbrüchigen hervorgeht – nur zögernd. Er umkreist ihn, stupst ihn zunächst allenfalls mit der Nase an, untersucht, ob dieses Etwas sich bewegt… Erst wenn sich nach mehreren solcher Versuche gezeigt hat, dass dieser Klumpen offenbar reaktionslos und ungefährlich ist, wird er angenommen. Und auch dann in der Regel erst ein kleines Stück, ehe größere Bisse folgen.“Entscheidend ist die allgemeine Schlussfolgerung: „So wie der furchtlose Krieger nur selten alt wird, würden auch Raubtiere, die ihren Fluchttrieb verlören, nicht lange überleben.“Die Vorstellung vieler Menschen von den vermeintlichen unerschrockenen und angriffslustigen Bestien – neben Haien zählen dazu beispielsweise Wölfe und Tiger – nähren sich nicht zuletzt von falschen Interpretationen der Evolutions- beziehungsweise Selektionstheorie Charles Darwins. Genau gesagt von Fehldeutungen seiner Formeln „Kampf ums Dasein“ und „Überleben der Tauglichsten“. Nach wie vor kann man immer wieder hören oder lesen, Darwin habe gemeint, dass nur die „Stärksten“ überleben. Das ist blanker Unsinn.Es ist zwar nicht zu leugnen, dass in der Natur, im Wettbewerb ums Dasein auch buchstäbliche Kämpfe unter Artgenossen stattfinden. Wohlgemerkt: Der natürliche Wettbewerb im Sinne Darwins bezieht sich auf Artgenossen und hat nichts zu tun mit dem Räuber-Beute-Verhältnis zwischen verschiedenen Arten (wie zum Beispiel Löwe und Zebra). Der Konkurrent ist stets ein Angehöriger der eigenen Spezies. Artgenossen haben die gleiche Lebensbedürfnisse, besetzen dieselben Nischen, wetteifern um die gleichen Geschlechtspartner(innen) und so weiter.Da es dabei stets um das eigene genetische Überleben, also erfolgreiche Fortpflanzung, geht, spielt sich der Wettbewerb keineswegs nach Prinzipien der Fairness ab. Es gilt bloß, möglichst lang im Spiel zu bleiben. Von einem buchstäblichen Kampf mit Zähnen, Klauen und Nägeln kann dabei aber keineswegs immer die Rede sein, weil viele Lebewesen über solche „Waffen“ gar nicht verfügen. Wann hat man denn schon Regenwürmer miteinander „kämpfen“ gesehen!Der Wettbewerb ums Dasein im Sinne von Darwin läuft auf Folgendes hinaus: Im Vorteil sind jeweils diejenigen Individuen, die über irgendwelche „Einrichtungen“ verfügen, die sie ihren Artgenossen im Durchschnitt überlegen macht. Der Feldhase, der etwas schneller laufen – und sich dadurch etwas besser vor Feinden schützen – kann als andere Individuen seiner Art, ist eindeutig im Vorteil. Jener Hase aber, der einem übermächtigen Feind mutig die Stirn bietet, wird nicht alt. Aus genau diesem Grund wurden den Feldhasen durch natürliche Auslese Laufbeine sozusagen angezüchtet. „Lauf, so schnell du kannst!“ lautet die Devise – und nicht: „Trau dich was!“Darwins Formel vom Überleben der Tauglichsten kann ohne Weiteres auch einmal als „Überleben der Feiglinge“ gedeutet werden. Denn eines ist klar: Die unerschrockenen Kämpfer, die sich jeder Gefahr stellen, werden mit nur sehr geringer Wahrscheinlichkeit das fortpflanzungsfähige Alter erreichen und genetisch überleben. Hierzu muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass viele Tierarten keine oder nur wenige Möglichkeiten haben, aufgrund ihrer Körperkraft in ihrer jeweiligen Umgebung zu bestehen. Sie sind gut beraten, sich zu verstecken, einzugraben, wegzulaufen und stets auf der Hut zu sein.Mut ist eine menschliche ErfindungEin eindrucksvolles Beispiel dafür sind die Gibbons in den „Großen Bergen“ von Thailand, über die der Primatenforscher Volker Sommer berichtet. Sie sind von vielen Feinden umgeben. Leoparden, Nebelparder und Marmorkatzen stellen ihnen genauso nach wie riesige Pythonschlangen und große Greifvögel. Mut würde ihnen angesichts dieser „Feinddrucks“ nichts nützen. Also sind sie zum einen sehr wachsam. Vor allem die Männchen verbringen viel Zeit mit Herumschauen. Zum Zweiten sind sie äußerst flink und können sich so in den Baumwipfeln relativ gut vor Raubkatzen und Schlangen schützen.Schließlich bieten den Gibbons ihre Schlafgewohnheiten einen gewissen Schutz. Sie ziehen sich schon tagsüber zurück, noch bevor die Katzen aktiv werden.Tiere sind im Allgemeinen recht scheu. Selbst so wehrhafte Geschöpfe wie Haie, Tiger oder Wölfe gehen kein Risiko ein; jedenfalls dann nicht, wenn ein Objekt ihrem üblichen Beuteschema nicht entspricht. Mut oder Tapferkeit sind Erfindungen des Menschen, die unzählige Individuen seiner Gattung schon das Leben gekostet haben. Imponiergehabe ist freilich in der Tierwelt weit verbreitet, man denke nur etwa an die Aufplusterungen eines Pfaus oder eines Truthahns. Von einer Brücke auf einen fahrenden Eisenbahnzug zu springen, um wem auch immer zu imponieren, ist jedoch eine Dummheit, zu der anscheinend bloß Menschen fähig sind (glücklicherweise nur sehr wenige).Insbesondere der von der Zivilisation beschützte und gelangweilte Mensch tendiert neuerdings dazu, sich durch waghalsige Unternehmen seinen „Kick“ zu verschaffen. Was allerdings zu großen Tragödien führen kann. So verloren im Juni 1999 in der Schweiz 21 Touristen beim sogenannten Canyoning (einer Mischung aus Schwimmen, Klettern und Wandern) entlang dem Wildwasser in einer Schlucht ihr Leben. Sie wurden von einem Gewitter überrascht, das den Wildbach schnell in ein gefährliches, reißendes Wasser verwandelte, ertranken, wurden mitgerissen, an Felsen zerschmettert oder von Baumstämmen erschlagen.Der moderne Abenteurer ist evolutionsbiologisch gesehen eine Anomalie und deutlich zu unterscheiden von jenen seiner Artgenossen, die im Dienste des nackten Überlebens die eine oder andere riskante Aktion wagen (zu wagen gezwungen sind). Hungernde Menschen wünschen sich gewiss nicht mehr als eine halbwegs sättigende Mahlzeit und danach etwas Ruhe. Über Abenteuertouristen können sie nur den Kopf schütteln.Unsere steinzeitlichen Ahnen würden sich über Spitzensportler sehr wundern, die am Rand der Erschöpfung körperliche Höchstleistungen vollbringen und diese manchmal sogar mit dem Leben bezahlen. Und ein Löwe, der seine Mahlzeit einmal erbeutet hat – was ihm große Anstrengungen abverlangen kann -, will nur in Ruhe gelassen werden und käme nie auf die Idee, an einem Marathonlauf teilzunehmen, bloß um danach unter Umständen geehrt zu werden. Aus der Sicht der Löwen wäre dies buchstäblich ein Leerlauf.Ohne die überall in der Natur herrschenden Verhältnisse einfach auf den Menschen zu übertragen, können wir doch festhalten, dass sich eine gewisse Portion Feigheit auch für den Menschen lohnt. Wie alle Organismenarten sind auch wir zum Überleben programmiert. Und da unser Leben viele Unwägbarkeiten und Risiken in sich birgt, die uns umgebende Welt voller Tücken und Gefahren ist, sind wir gut beraten, Vorsicht walten zu lassen. Die Evolution hat in uns Strategien eingebaut, die – zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit – das Überleben ermöglichen. Sich verstecken, davonlaufen, einer Gefahr ausweichen, in Deckung gehen – diese und ähnliche Strategien sind lebensdienlich, machen sich so gut wie immer bezahlt.In einem moralischen Sinn ist Feigheit immer dann geboten, wenn dadurch Menschenleben geschützt werden. Zu ehren sind nicht die tapferen Krieger, die bereit sind, andere zu besiegen und dafür ihren eigenen Kopf riskieren, sondern die Feiglinge, die erst gar nicht gewillt sind, in einen Krieg zu ziehen und schon in dessen Vorfeld das Weite suchen.Unsere Literaturgeschichte ist von zahlreichen Helden bevölkert. So gibt es die „Deutschen Heldensagen“, aber keine „Feiglingssagen“. Viele Helden sind jedoch von einer Tragik umflort. Sie werden nach ihrem Tod geehrt, wovon sie nichts haben. Den in den beiden Weltkriegen gefallenen Soldaten sind unzählige Kriegerdenkmäler gewidmet, die – wie gut gemeint sie auch sein mögen – über die Tragödien, die sich abgespielt haben, eigentlich hinwegtäuschen. Viele, wenn nicht die meisten, der in Kriegen getöteten Soldaten wollten gar keine Helden sein. Sie waren und sind bloß Opfer militärischer Propaganda im Dienste verbrecherischer Ideologien. Und wo die Fahne weht, bleibt bekanntlich der Verstand in der Trompete. „Soldatenehre“ ist aus biologischer Sicht kontraproduktiv.Der Mensch ist ein sonderbares Lebewesen. Ist er einerseits, wie alle anderen Arten, zum Überleben programmiert, so hat er andererseits Idealbilder seiner selbst entworfen und gebietet sich mitunter, über sich selbst gleichsam hinauszuwachsen. Immer mehr, immer höher, immer schneller - wer kritisch um sich blickt, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass unsere Zivilisation ein Stadium erreicht hat, welches unsere natürlichen Leistungskapazitäten allmählich überfordert. Es gilt, Rekorde aufzustellen, deren Preis nicht mehr kalkulierbar ist. Im Sport, in der Wirtschaft, im täglichen Leben heißt es, Bewährungsproben zu bestehen, die den Einzelnen leicht überfordern.Es ist höchste Zeit, dass wir uns auf individuelle Werte in unserem Leben besinnen; eine gute Portion Feigheit kann uns dabei helfen.Tapferkeit im Dienst der MächtigenMan verstehe mich nicht falsch: Ich plädiere weder für einen völligen Rückzug ins eigene Schneckenhaus noch für jene gesellschaftlich gefährliche Form des Duckmäusertums, die sich im Wegsehen und Übersehen von Missständen manifestiert. Vielmehr plädiere ich für eine Wertschätzung des Individuums und des persönlichen Lebensglücks, das überall dort mit Füßen getreten wird, wo es heißt, der Einzelne hab sich dem Kollektiv zu opfern. In der abendländischen Tradition (aber nicht nur in dieser) kommt das Individuum immer wieder unter die Räder gefährlicher Ideologien. Es wird zur Tapferkeit aufgefordert, weil diese den Machthabern opportun erscheint. Inzwischen hat die Wirtschaft fast schon religiöse Dimensionen angenommen und greift in die Politik ganz entscheidend ein. Auch ihr gilt Mut als Kardinaltugend – der Mut zur Expansion, der Mut zum Risiko… Aber es sind oft zweifelhafte Figuren, die dabei als Helden gefeiert werden: Topmanager mit Spitzengagen, die ihre Betriebe „gesundschrumpfen“, indem sie Tausende Mitarbeiter auf die Straße setzen.Erfordern aber nicht gerade solche Strategien vom Einzelnen eine gehörige Portion Mut? Nicht unbedingt, es ist eine Frage der Rahmenbedingungen. Wer selbst fest im Sattel sitzt, das heißt wirtschaftlich ausgezeichnet gepolstert ist, kann leicht Schritte unternehmen, die nur anderen schaden. Und wer es geschickt angeht und andere zu manipulieren weiß, kann selbst im eigenen Schneckenhaus verweilen, während andere – für ihn! – Mut beweisen. Denken Sie daran, wenn Sie wieder einmal jemand auffordert: „Habe Mut!“ „Trau dich doch!“ Und noch eines: Es zeigt sich, dass die optimale Lösung von Konfliktsituationen die ist, bei der es keinen Sieger und keinen Verlierer gibt.Ein kleiner Rückzieher, mit dem man ja nicht gleich das Gesicht verlieren muss, ist viel klüger als kämpfen bis zum Umfallen.
Franz M. Wuketits, Handelsblatt, Seite 9
"Ein sehr, sehr lesenswertes Buch."
Hr2 Buchbesprechungen
"… ein lesenwertes Buch, schärft es doch des Lesers Verstand und Kritik."
Der evangelische Buchberater
"… ein tiefgründiges, ein wichtiges Buch, das neue Einsichten vermittelt. Empfehlenswert."
denkladen.de

Prof. Dr. Franz M. Wuketits
| ISBN | 978-3-7776-1602-5 |
|---|---|
| Medientyp | Buch - Gebunden |
| Auflage | 1. |
| Copyrightjahr | 2008 |
| Umfang | 186 Seiten |
| Format | 13,0 x 21,0 cm |
| Sprache | Deutsch |